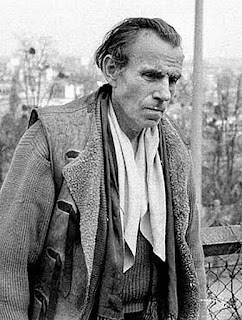[Eigentlich Schalom Jakob Abramowitsch, 21. 12.1835, jul. / 2.1.1836, greg. -25. 11., jul. / 8.12.1917 greg.]
Wikipedia
Das erste Kapitel aus "Fischke der Krumme" (1869)
Der Vorspruch des Mendele Moicher Sfurim, da er mit eigenen, zum erstenmal gedruckten Schriften vor die Welt tritt
»Wie ist Euer Name?« Das ist die erste Frage, die ein Jude einem Wildfremden gleich bei der ersten Begegnung stellt, sobald er ihm Willkommen gesagt hat. Niemandem fällt es dabei ein, daß man dagegen zum Beispiel antworten könnte: »Was liegt Euch denn so sehr daran, zu wissen, wie ich heiße, Herr Gevatter? Wollen wir denn unsere Kinder miteinander verheiraten? Ich heiße so, wie man mich nannte, und nun laßt mich in Ruhe!« Nein, im Gegenteil, die Frage nach dem Namen ist etwas ganz Natürliches, das liegt schon so in der Sache, gerade so wie man den neuen Rock eines andern befühlt und dabei fragt: »Wie teuer? Was kostet die Elle?« Oder so wie man unaufgefordert eine Zigarette nimmt, wenn jemand seine Büchse öffnet. Oder so wie man seine Finger in eine fremde Schnupftabakdose steckt und sich eine Prise nimmt. Oder so wie man den Fuß in die Wanne eines andern steckt, sein schmieriges Tüchlein dort eintunkt und sich den Körper einreibt. Oder so wie man verstohlen in ein fremdes Machser hineinschaut und aus Anstand schnell umblättert, während der Besitzer die Worte des Gebetes noch gar nicht recht begriffen hat. Oder so wie man hinzutritt, wenn sich zwei Leute unterhalten, sein Ohr hinhält und sich ihr Gespräch anhört. Oder so wie man jemanden urplötzlich und unerwartet nach seinen Geschäften fragt und sich ihm mit Ratschlägen aufdrängt, obwohl sie jener durchaus nicht nötig hat und sehr wohl ohne sie und ohne ihn auskommen kann. Diese und ähnliche Dinge sind bei uns Juden sehr verbreitet. So ist der Lauf der Welt seit ewigen Zeiten, und sagte man etwas dagegen, so täte man was Verrücktes, etwas ganz Absonderliches, ja es wäre gar gegen die Natur. Nicht nur für das Diesseits, auch fürs Jenseits haben die Juden die Überzeugung, daß man bloß seinen Fuß hinüberzusetzen braucht und sofort vom Totenengel mit der Frage begrüßt wird: »Wie heißt Ihr, Herr Gevatter?« Selbst der Engel, der mit unserm Vater Jakob rang, wich auch nicht vom Wege der Welt ab und fragte ihn nach Brauch und Sitte um seinen Namen. Wenn dies schon bei Engeln so ist, um wieviel mehr dann bei sündhaften Menschen, den Geschöpfen aus Fleisch und Blut. Ich weiß sehr wohl, wenn ich zum erstenmal mit meinen Erzählungen in die jüdische Literatur hinaustrete, wird es gewiß die erste Frage der Leute sein: »Wie ist Euer Name, Gevatter?«
Mendele heiße ich! So nannte man mich, liebe Leser, nach einem Urgroßvater mütterlicherseits, nach Reb Mendele Moskauer seligen Andenkens. Moskauer hieß er zu seinen Zeiten darum, weil er, wie man erzählte, einmal gar bis nach Moskau gekommen war, um dort russische Ware einzukaufen, und sich fein still wieder davongemacht hatte, bevor man noch daran dachte, ihn auszuweisen. Nun, davon wollte ich nicht sprechen. Aber in Moskau, beim Moskowiter, war er doch gewesen. Das brachte in seiner Gegend Namen und Ehre ein. Alle betrachteten ihn als erfahrenen, welttüchtigen Menschen, der in der ganzen Welt herumgekommen war, und wenn es irgendeine Not gab oder wenn man ein russisches Gesuch zu schreiben hatte, so beriet man sich mit ihm. Aber nicht davon wollte ich sprechen.
Damit ist man aber noch lange nicht fertig. Nach dieser ersten Frage beginnen bei den Juden erst allerlei Fragen zu strömen, wie zum Beispiel: »Woher seid Ihr? Seid Ihr verheiratet? Habt Ihr Kinder? Womit handelt Ihr? Wohin fahrt Ihr?« Und noch viele ähnliche Fragen, die man in ganz Israel stellt, wenn man vor den Leuten sehen und zeigen will, daß man Gottlob ein herumgekommener Mensch und kein Stubenhocker sei, und auf die man nach dem Gesetz antworten muß, so wie »Gutes Jahr« auf den Wunsch »Guten Schabbes« oder »Guten Jontew«. Ich will es nicht mit der ganzen Welt zu tun bekommen und bin bereit, alle diese Fragen auch so kurz und bündig wie möglich zu beantworten.
Ich bin aus Heuchlingen gebürtig, einem ziemlich großen Städtlein im Gouvernement Dösenheim. Die Stadt ist durch ihre Güte und ihre Frömmigkeit berühmt, so wie Dümmingen zum Beispiel durch Klugheit, Schnorringen durch seinen Reichtum, Faulburg durch seine Industrie – lauter schöne Gegenden mit Vorzügen, die auf den Zustand der Juden hier auf diesem Flecken des Exils wirken. Aber nicht davon wollte ich sprechen.
In meinem Passe steht freilich ausdrücklich das Alter angegeben, aber wie alt ich wirklich bin, kann ich euch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie das bei Juden schon so üblich ist. Meine seligen Eltern gingen in der Berechnung meiner Jahre bedeutend auseinander. Nach beiden wurde ich am ersten Channeke-Abend während des großen Brandes der Läden geboren. Aber nach der Rechnung des Vaters war das damals, als die großen Kälten in unsere Gegend eingeschleppt wurden, gerade um die Zeit, als der Alte, gesegneten Andenkens, verschied. Meine Mutter wiederum bewies, es wäre an die zwei Jahre nach der ersten Panik gewesen. Sie hatte sogar ein Zeichen: Damals hatte bei uns die rote Kuh gekalbt, und am letzten Channeke-Tag hatte sie für die halbe Stadt Käsekrapfen gemacht, bei denen sich die Leute alle fünf Finger ableckten, und die einigen alten Leuten noch heute auf der Zunge lägen. Man muß Zeit haben und tüchtig sein, um sich in solche Berechnungen zu versenken, wie die Faulburger Gehirnmenschen. Aber nicht davon wollte ich sprechen.
Die Personbeschreibung in meinem Passe lautet: Wuchs – mittelgroß; Haar und Brauen – grau; Augen – schwarz; Nase und Mund – normal; Bart – grau; Gesicht – rein; besondere Merkmale – nicht vorhanden. Das heißt, alles in allem ganz gewöhnlich, nichts Besonderes, ein Mensch wie alle andern, kein Vieh, behüte. Nun, dann fragt es sich doch: Ein Paß ohne jede Personbeschreibung beweise ja auch, daß man ein Mensch ist?! Wo hat etwa das Vieh einen Paß? Dieser Einwand wird dadurch widerlegt, daß Einwendungen keinen Sinn haben. Das ist ja der ganze Sinn, daß einem die Personalbeschreibung vorgesetzt wird und man doch nicht weiß, wie das Gesicht aussieht. Und wirklich, wozu wollen wir uns täuschen, was habt ihr schon davon, wenn ihr zum Beispiel wißt, daß meine Stirn hoch ist und viele Falten hat; daß meine Nasenlöcher sehr groß und ein wenig sonderbar sind; daß mein Gesicht nach außen hin so wie zornig aussieht. Wenn ich schaue oder etwas betrachte, mache ich meine kleinen, kurzsichtigen Augen ein wenig zu, und wenn ich die Lippen verziehe, scheint auf ihnen ein mild-stechendes Lächeln zu schweben. Ach, das ist ja wirklich Unsinn. Sogar meine Frau hat sich vor unserer Hochzeit nicht um solche Kleinigkeiten gekümmert. Sie nahm mich wie einen blinden Essreg, ohne vorher mein Gesicht anzusehen – und es ging! Nun wißt ihr auch schon, meine lieben Leser, daß ich verheiratet bin. Von Kindern braucht ja gar keine Rede zu sein. Selbstverständlich habe ich welche, unbeschrien sogar viel. Was denn anders hat der Jude? Aber nicht davon wollte ich sprechen.
Mein Geschäft ist der Buchhandel, wie ihr mich da seht. Ich hatte in meinem Leben alle möglichen Berufe, ich hatte mich nach allen Decken gestreckt, bis ich endlich eine wegwerfende Handbewegung machte – zum Teufel mit allen Berufen – und den Buchhandel begann. Und dabei bin ich bis heute geblieben.
Dann wären Bücher also, könnte man meinen, das beste Geschäft, ich würde gar reich! Und daraufhin werden die Juden diese armen Teufel schmachten ja nach Erwerb und tun darum einer dem andern nach – sich wie die Heuschrecken auf den Buchhandel stürzen. Nun, so schwöre ich euch, ihr Juden, daß ich ein armer Mann bin! Das eigentliche Buchgeschäft, der Chimmesch-, Szidder-, Machser-, Sliches-, Kines-, Tchines-, Bentscher-Handel bringt einem nicht einmal das Wasser zum Brei ein, wie man sagt, darum muß ich auch Berscheter Arbekanfes mit mir führen. Dubrower Talejssem, achtfache Zizzes, Reziees, Schoifres, Hejs, Mesises, Wolfszähne, Muscheln, Amulette, Kinderschuhe und Kinderkäpplein und manchmal auch Messing- und Kupferzeug. Wieso Messing- und Kupferzeug zu Büchern kommt, weiß ich selbst nicht. Aber so ist es bei uns schon mal der Brauch, genau so wie ein Schriftsteller mal auch ein wenig Heiraten vermitteln muß, wie der Schammes in einer polnischen Klous einen kleinen Ausschank halten, wie ein Gemeindemann auf einem Fest bei den feinen Leuten manchmal Fische kochen und Kellner sein muß, wie der Rabbi eines Städtleins sein Einkommen von der Hefe haben muß. Bei all diesen Dingen schwöre ich euch, besitze ich keinen Pfennig an Vermögen.
Es ist ein wunderbares Glück, daß man zu einem Buchhandel wie dem meinen kein großartiges Magazin mieten muß. Dafür genügt ein beliebiges Wäglein und ein beliebiges Rößlein. Ist das Rößlein ein wenig alt und schäbig, hinkt es ein bißchen und kann kaum die Beine heben, so mag das auch noch lange nichts ausmachen. Hetzen, Postfahren hat man nicht nötig. Man packt sich sein Wäglein voll, deckt eine Plane darüber und zockelt munter drauflos. Daß Glöcklein dabei klingen, ist überflüssig, man ersetzt sie durch das Knarren der Räder. In Gasthöfen in besonderen Nummern für sich mit großem Pomp Quartier zu nehmen – das braucht man auch nicht zu tun, sondern fährt sofort beim Bejssmedresch vor. Der Wagen bleibt auf dem Hof stehen. Das ausgespannte Pferd steht da, frißt Häcksel, wenn es nur welches bekommt, aus einem Leintuch, das zwischen den hochgestellten Deichselstangen ausgebreitet ist. Daß die Kinder sich heimlich dahintermachen und ihm verstohlen Saiten aus dem Schweife zupfen – ist weiter auch kein Unglück. Wenn man will, kann man es völlig schwanzlos haben, ganz nach der Mode. Aber das ist ja Tierquälerei?! I wo. Mein Tölpel steht ganz ruhig da und läßt sich's gar nicht nahegehen. Manchmal läßt er die Unterlippe hängen, steckt die Zungenspitze heraus und scheint wie ein Mensch zu grinsen. Trifft es sich mal, daß er nichts zu fressen hat, dann steht er nachdenklich mit erhobenen Ohren und blickt auf die Bücher im Wagen, so daß man schwören möchte, sein Pferdehirn erfasse sie sehr wohl und gehe mit ihnen verflucht gelehrt um. Aber nicht davon wollte ich sprechen.
Also wenn ich Gottlob mein Pferd auf dem Schihl-Hof versorgt habe, nehme ich mir einen Platz im Bejssmedresch. Am Tage lege ich meine Bücher für die Leute aus, auf dem langen, schmierigen Tisch am Eingang neben dem Ofen, bei Nacht lege ich mich selbst auf die Bank und tue, als ob ich hier zuhause wäre, und schlafe, was das Zeug hält. All mein bißchen Diesseitsglück habe ich umsonst und mit vielen Ehren.
Wenn dem nun so ist, wenn es da ein Herumgewandere, Herumgeirre und Geschnorre gibt, so erhebt sich ja die Frage: Welcher Teufel hat mich zum Buchhandel gebracht? Und wozu bleibe ich bis auf den heutigen Tag bei solchem Geschäft? Es fällt mir zwar schwer, darauf zu antworten, aber ich habe keine Wahl.
Meine lieben Leser, ich bekenne! Eine Schwäche habe ich seit meiner Kindheit, die bei den Fremden »Liebe zur Natur« heißt, zu allem, was wächst, was sprießt, was lebt und auf der Welt ist. Da zieht mich etwas an und treibt mich irgendwohin. Da haftet mir ein Tand im Sinn, ein schönes Gesicht, eine herrliche Form, ein Grashalm, ein Baum, eine Rose, ein Vogel.
»Aber, aber«, wird man sagen, »schämt Ihr Euch denn nicht, ein bärtiger Mann, ein Mensch, der Nahrungssorgen, der Frau und Kinder hat, der nach dem Lauf der Natur Sorgen haben, nachdenken und grübeln muß, daß es einen Zweck habe?! Und außerdem, schämt Ihr Euch denn nicht ganz einfach, an solchen Unsinn zu denken, Natur – papperlapur, solch Bubenzeug!« Ach, ich weiß es, ich weiß es sehr wohl, daß so etwas für einen Juden unpassend ist, aber was soll ich denn anfangen, wenn das bei mir eine angeborene Schwäche ist, ein Trieb, der mich wie ein Magnet anzieht. Und gar noch gerade dann, wenn ich mich mit ernsten, wichtigen Dingen beschäftige, wie mit Jüdischkeit zum Beispiel oder mit Geschäftsdingen. Mitten in der Mondweihe – stellt euch vor, gerade mittendrin im besten Beten, im Körperschütteln unter den Leuten, reißt es mich gleichsam zu dem schönen blauen, bestirnten Himmel mit dem versonnenen, schwermütigen, herrlichen Mond empor, meine Gedanken sind Gott weiß wo, bei hellen Gesichtern, schönen, brennenden, nachdenklichen Augen, Geseufze, Geraune, dichtbeasteten Linden. Man könnte mich unter Eid fragen, ich wüßte nicht, was mein Mund plappert. Mein Nebenmann sagt zu mir: »Friede über Euch«, und ich erwidere ihm: »Komm, o Freund, der Braut entgegen!«
Ebenso ist es mit dem Essreg, mit dem Lielew, mit dem Schanes. Ich vergesse die Mizwe, die Intention auf Einung, die in ihnen liegt und denke nicht weiter an Gott und seine Glorie, sondern erquicke mich daran, wie wunderschön frisch sie duften. Der Gang zu Taschlech, eine so ernste jüdische Angelegenheit, da man die Sünden von sich wirft, wird mir gar zu einem schönen Spaziergang. Wenn ich dort die Gebete spreche, dann schauen meine Augen auf den Fluß, auf die grüne Flur, die sich drüben auf dem andern Ufer weit in die Ferne erstreckt. Ich sehe das laufende, murmelnde Gewässer vor mir, stolz schwimmende Gänse, ein Lüftlein weht, hochgewachsenes Schilfrohr flüstert, ein Weidenbäumlein spiegelt sich und badet seine Zweige im Wasser. Klar ist der Himmel, die Luft frisch, göttliche Stille in Tälern, auf Hügeln, in Wäldern überall. Irgend etwas reißt an meiner Seele, Sehnsucht, Verlangen – oh, mein Gott! – ich weiß selbst nicht wonach. Für Spazierengehen gebe ich mein Leben her. Auf dem Felde und im Walde bin ich gar nicht der gleiche wie in der Stadt, da bin ich frei, da bin ich des Joches ledig. Was scheren mich da Frau und Kinder, was Jude, was Sorgen! Ich bin froh, ich ergötze mich in seliger Wonne an den Werken des Herrn, ich gebe mich mit allen Sinnen hin und gehe unter in Gottes Welt, in Gottes schöner Welt.
Diese arge Leidenschaft, o weh, war es, die in mir bohrte und brummte: »Mendel, der Buchhandel ist wie für dich geschaffen! Und wenn du etwas versetzen müßtest, das bißchen Schmuck deiner Frau – kaufe ein Pferd und einen Wagen, packe ihn mit Büchern voll und fahre in die weite Welt. Verdienen hin, Verdienen her, Hauptsache ist das Reisen, die Freude, die du haben wirst, wenn du unterwegs so viel Schönes siehst und hörst. Du wirst da auf der Fahrt behäbig wie ein Kaiser auf deinem Wagen liegen und jedes Stücklein an den kunstvollen, schönen Werken Gottes betrachten, seine Geschöpfe in Bergen und Tälern, auf Feldern und in Wäldern. Das Rößlein wird ganz, ganz langsam zockeln und du wirst schauen und schauen. So wird es unterwegs sein, und wenn du in Städtlein und Städte kommen wirst, wirst du verschiedene Menschen sehen, feine Leute, große Herren, sonderbare Geschöpfe, allerlei Personen, gebogene Rücken, hochgehobene Nasen, langhändige, klebrigfingrige, alle möglichen Arten, vom alten und vom neuen Schnitt, dann wirst du von ihnen Geschichten zu erzählen wissen, du wirst zu singen und zu sagen haben.«
Nun, wißt ihr es jetzt, meine lieben Juden?
Heute, da ich eine ziemliche Weile umhergereist bin, bohrt und brummt der böse Trieb wieder in mir: »Geh«, sagt er, »geh und drucke die Geschichten, die du von den Juden aus der ganzen Zeit zu erzählen hast, da du dich unter ihnen herumgetrieben hast! Oh, sie dürfen es ruhig hören, es wird ihnen behüte nichts schaden!«
»Na, meinetwegen«, überlegte ich's mir, »ich werde es tun.«
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was nottut. Übrigens bin ich ja nicht mehr als ein Mensch. Sollte ich etwas vergessen haben, dann werde ich es, wenn ich mich erinnere, in einem meiner späteren Bücher sagen. Und wenn jemand ungeduldig sein sollte und alles sofort bis auf den I-Tipfel wissen wollen wird, dann mag er so gut sein und mir schreiben, er wird von mir bald eine klare Antwort haben.
Meine Adresse ist: »Mendelju Jidelewitschu Moicheru Sfuremu uw gorodi Heuchlingu« – An Mendel Jidelewitsch Moicher Sfurim in der Stadt Heuchlingen. Den Titel »Gospodinu jewreju«, »An den Herrn Juden«, braucht man nicht zu schreiben, man weiß es ohnehin.
 H. G. Adlers poetisches Werk
H. G. Adlers poetisches Werk Demokratie und Macht. Widerspruch 60
Demokratie und Macht. Widerspruch 60